Guten Morgen {{vorname}}
Rechte Kreise behaupten, die Personenfreizügigkeit mit der EU schade der Schweiz. Ein neuer Seco-Bericht zeigt jedoch das Gegenteil: Die Zuwanderung aus der EU/EFTA stärkt die Wirtschaft, ergänzt den Arbeitsmarkt, bremst die demografische Alterung und entlastet sogar die Sozialwerke – ein willkommener Befund für die Befürworter:innen der neuen EU-Verträge.
Neuer Bericht zur Personenfreizügigkeit
Seco lobt EU-Zuwanderung als Motor des Wirtschaftswachstums
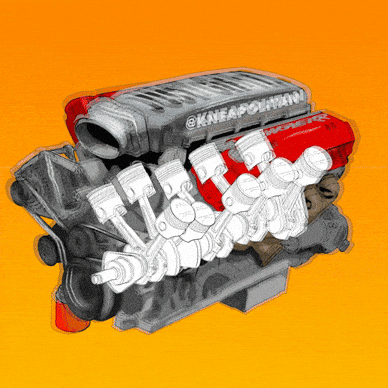
Die hohe Einwanderung aus der EU/EFTA treibt das Wirtschaftswachstum an, findet das Seco. (GIF: Giphy)
Gestern ist der neue Seco-Bericht zur Personenfreizügigkeit erschienen. Für die Befürworter:innen der neuen EU-Verträge kommt dieser zu einem guten Zeitpunkt, denn er liefert ihnen wichtige Argumente. Insgesamt lautet das Fazit nämlich: Die anhaltend hohe Zuwanderung aus der EU/EFTA wirke sich positiv auf die Schweizer Wirtschaft aus.
Hier sind die wichtigsten Ergebnisse des Berichts:
Der grösste Teil der EU-Zuzügler:innen stammt aus Deutschland (29 Prozent), Frankreich und Italien (je 14 Prozent) sowie Portugal (zwölf Prozent).
Mit 86,8 Prozent liegt ihre Erwerbsquote um knapp zwei Prozentpunkte höher als bei den Schweizer:innen. In anderen Worten: Sie arbeiten mehr.
Der Medianlohn der Schweizer:innen ist höher als derjenige von EU/EFTA-Zuzügler:innen. Am grössten sind die Lohnunterschiede bei Grenzgänger:innen, weshalb dort auch die höchste Gefahr für Lohndumping besteht.
Die Zuwanderung verdrängt einheimische Arbeitskräfte nicht, sondern ergänzt sie: Die Erwerbsbeteiligung ist in der Schweiz gestiegen, besonders bei Frauen.
Trotz Zuwanderung bleibt die demografische Alterung herausfordernd, da der Anteil der Erwerbstätigen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung langsamer wächst.
EU/EFTA-Zugewanderte beanspruchen im Vergleich zu Schweizer:innen die AHV etwas weniger, dafür die Arbeitslosenversicherung etwas mehr. Trotzdem ist das Seco-Fazit: Für die Sozialwerke ergibt sich insgesamt keine Mehrbelastung.
Diese Befunde stimmten auch den Direktor des Arbeitgeberverbands, Roland A. Müller, feierlich. «Zuwanderung […] stärkt die Beschäftigung, stabilisiert die Sozialwerke, federt die Alterung ab und schafft Wohlstand», sagte er in seiner Ansprache.
Einzig der SGB-Chefökonom Daniel Lampart störte die Feierlaune ein wenig, wie die NZZ bemerkt. Zwar unterstützt auch er die neuen EU-Verträge mittlerweile. Doch anstelle der vom Bundesrat ausgearbeiteten «Schutzklausel» unterstrich er die Wichtigkeit flankierender Massnahmen als wirksameres Mittel, um die negativen Folgen der Zuwanderung abzudämpfen.
Debatte um Kernenergie
Expert:innen sagen: AKWs erst ab 2050 realistisch

Das AKW in Beznau soll 2033 altersbedingt eingestellt werden. (Foto: Wikipedia)
Braucht die Schweiz neue Kernkraftwerke?
Eigentlich sind bei dieser Frage die Weichen schon gelegt: 2017 stimmten die Stimmbürger:innen für ein Verbot neuer AKWs. Ferner wurde im Juni 2024 die Initiative zum «Stromversorgungsgesetz» mit knapp 70 Prozent deutlich angenommen. Das Gesetz sieht einen raschen Ausbau erneuerbarer Energien in den nächsten Jahren vor.
Doch spätestens seit dem russischen Angriff auf die Ukraine und der angespannten geopolitischen Weltlage wird die Forderung immer lauter, die Schweiz müsse in Sachen Energieversorgung eigenständiger sein. Und dafür brauche es nebst erneuerbaren Energien auch mehr Kernkraft. Entsprechend fordert die «Blackout-Initiative» eine Aufhebung des bestehenden Verbots für neue Kernkraftwerke.
Doch wie realistisch ist diese Forderung?
Eine soeben veröffentlichte Studie der Energiekommission der Akademien der Wissenschaften Schweiz (SCNAT) möchte nun der Debatte eine wissenschaftliche Grundlage liefern, ohne sich explizit für oder gegen Kernenergie auszusprechen.
Trotzdem spricht im Bericht nicht gerade sehr vieles dafür, wie dem SRF zu entnehmen ist.
Auch wenn ein neues AKW einen wesentlichen Anteil zur Stromversorgung leisten könnte, würde das nur für den Winter gelten. Denn im Sommer wird in der Schweiz schon genügend Strom produziert. Während dieser Zeit müsste das AKW abgestellt werden, ansonsten drohten noch grössere Verluste.
Ausserdem könnte ein neues AKW aufgrund der vielen Planungs- und Bewilligungsverfahren, Volksabstimmungen sowie allfälligen Einsprachen aller Wahrscheinlichkeit nach frühestens 2050 in Betrieb genommen werden.
Auch die Kosten würden sich schätzungsweise im zweistelligen Milliardenbereich bewegen. Zahlen müsste dies ferner der Staat, da Private unter den gegebenen Rahmenbedingungen kaum bereit wären, solche Summen zu investieren.
Studie zu Wohnungsknappheit
Wegen Einsprachen zu wenig Wohnungen

Wegen Einsprachen verzögern sich viele Wohnbauprojekte. (Foto: Unsplash)
Die Schweiz wächst und wächst, allerdings nicht bei den Wohnungen. Schlimmer noch: Die Bautätigkeit ist sogar rückläufig.
Weshalb?
Steigende Materialkosten, Bodenpreise, höhere Zinsen und strenge gesetzliche Auflagen, um nur einige zu nennen.
Der Hauptgrund für Verzögerungen von Wohnbauprojekten scheint jedoch ein anderer zu sein: Einsprachen. Zu diesem Schluss kommt eine neue vom Bund beauftragte Studie.
«Es ist heute schlicht zu einfach, Wohnbauprojekte zu verhindern oder zu verzögern.»
Die Studie ist Teil des Aktionsplans «Wohnungsknappheit». Bund, Kantone, Gemeinden und die Bauwirtschaft wollen mit einem Massnahmenkatalog mehr bezahlbaren und bedarfsgerechten Wohnraum schaffen. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren gelegt.
Für die aktuelle Studie wurden 440 Jurist:innen, Bauherren und Beamte zu den Hürden bei neuen Bauprojekten befragt. Über 60 Prozent gaben an, dass Einsprachen und Rekurse der Realisierung von neuen Wohnbauprojekten im Wege stünden. Zum Vergleich: Nur 37 Prozent sahen raumplanerische Vorgaben als grosse Hürde an.
Besonders ärgerlich seien «missbräuchliche Einsprachen», die lediglich dazu dienten, Bauprojekte zu blockieren oder zu verzögern oder gar die Bauherrschaft zu nötigen oder zu erpressen.
In den meisten Fällen führten solche Einsprachen zu einer Teuerung.
Gegenüber CH Media sagt die Co-Autorin der Studie, Joëlle Zimmerli: «Es ist heute schlicht zu einfach, Wohnbauprojekte zu verhindern oder zu verzögern.»
Das wären mögliche Lösungen:
Die potenziellen Kosten für die Verzögerung werden teilweise auf die Einsprechenden abgewälzt.
Wollen Nachbar:innen einsprechen, müssen sie zuerst nachweisen, wie das Bauprojekt sie konkret betreffen würde.
Verdichtungsbestrebungen sollen gegenüber dem Heimatschutz Vorrang haben.
Zahl des Tages
66 Vollzeitstellen
Die Saftkur beim SRF geht munter weiter. Zuerst wurde bekannt, dass beim französischsprachigen RTS 60 bis 70 Stellen gestrichen werden sollen. Nun fallen auch am SRF-Standort im zürcherischen Leutschenbach ganze 66 Vollzeitstellen dem Sparprogramm zum Opfer. Das Programmangebot soll allerdings nicht betroffen sein. Gespart werden sollen dadurch zwölf Millionen Franken, berichtet der Blick.
Kurz-News
Parlament untersucht Fixpreis für F-35-Jets · Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats kündigte gestern eine Untersuchung zum angeblichen Fixpreis bei der Beschaffung der F-35-Jets an. Geprüft werden soll, wie sich die zuständigen Stellen mit den entsprechenden Gutachten und der Kritik der Eidgenössischen Finanzkontrolle von 2022 auseinandergesetzt haben. Auch Alt-Bundesrätin Viola Amherd könnte vorgeladen werden, schreibt die NZZ.
Keller-Sutter trifft Macron · Am Dienstag traf Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Entgegen vieler Erwartungen wurde aber kaum über den F-35-Kauf gesprochen. Frankreich hatte damals der Schweiz ihre eigenen Rafale-Jets offeriert. Im Zentrum der Gespräche standen jedoch geopolitische Fragen, insbesondere über die Rolle Genfs als Verhandlungsplattform für Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland. Darüber berichtete der Blick.
Zürcher Stadtpolizei setzt weiterhin Gummischrot ein · Die Stadtpolizei Zürich möchte weiterhin Gummischrot einsetzen. Dies, obwohl Gummischrot zu schweren Verletzungen führen kann, auch bei Unbeteiligten. Ab September 2025 muss aber jeder Einsatz systematisch dokumentiert werden. Die Schweiz setzt als einziges westeuropäisches Land solche Streumunition ein, schreibt der Tages-Anzeiger.
International
Macron telefoniert mit Putin · Zum ersten Mal seit fast drei Jahren haben Emmanuel Macron und Wladimir Putin miteinander telefoniert. Während bezüglich der Notwendigkeit internationaler Abkommen zur nuklearen Abrüstung gewisse Einigkeit herrschte (im Zusammenhang mit der Eskalation im Iran), kam es bezüglich des Krieges in der Ukraine zu keiner grossen Annäherung, schreibt die New York Times.
Supergau
🔧 Nützliches des Tages
Was tun im Falle eines Super-GAUs?
Gibt es in einem Schweizer Kernkraftwerk einen Störfall, der zu einer Gefährdung der Bevölkerung anwachsen könnte, dann wird der allgemeine Alarm ausgelöst. Und zwar zweimal.
Beim ersten Mal heisst es: Schutzmassnahmen vorbereiten. Dazu gehört:
Jodtabletten nicht vergessen!
Beim zweiten Mal dann: Ab in den Schutzraum. Und:
Jodtabletten fressen!
Alles Weitere findest du auf www.jodtabletten.ch.
🎲 Rätsel zum Schluss
Errate im 6iBrief Rätsel das gesuchte Wort in höchstens sechs Versuchen. Jeden Tag gibts ein neues Wort zu erraten.
Das Wochenthema: Kultur
So funktioniert es:
Du gibst ein Wort ein.
Grün: Buchstabe ist richtig und am richtigen Ort.
Orange: Buchstabe ist im Wort, aber an der falschen Stelle.
Grau: Buchstabe kommt im Wort nicht vor.
Viel Spass beim Knobeln!
Macheds guet!
Jonas

